oceans
Type of resources
Available actions
Topics
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
-
„Die EU-Wasserrahmen-Richtlinie schafft einen Ordnungsrahmen für den Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers. Für oberirdische Gewässer gelten die folgenden Ziele: Verwirklichung des guten ökologischen und chemischen Zustandes bis 2015; Verwirklichung des guten ökologischen Potenzials und des guten chemischen Zustands bei erheblich veränderten oder künstlichen Gewässern bis 2015; Verschlechterungsverbot; Bei künstlichen und erheblich veränderten Oberflächengewässern kann nach sorgfältiger Prüfung der Verbesserungsmöglichkeiten die Ausweisung als erheblich verändertes Gewässer erfolgen. Bei diesen Gewässern, bzw. bei Gewässerabschnitten, bei denen der gute ökologische Zustand nicht oder nicht mit verhältnismäßigen Mitteln wieder hergestellt werden kann und wenn durch die Wiederherstellung bestimmte Nutzungen, wie Wasserkraft, Schifffahrt, Hochwasserschutz entscheidend beeinträchtigt würden, muss nicht der gute ökologische Zustand erreicht werden, sondern das gute ökologische Potenzial. Die Richtlinie definiert den ‚guten ökologischen Zustand’ als ein Ziel, das bis 2015 (in Ausnahmen auch bis 2027) erreicht sein soll. Vor diesem Hintergrund ist es zunächst notwendig, den aktuellen Zustand der Gewässer zu beurteilen und damit den erforderlichen Handlungsbedarf im Hinblick auf das Ziel der WRRL aufzuzeigen. Um diesen ersten Schritt durchführen zu können, ist die Entwicklung geeigneter Bewertungsverfahren für die von der WRRL vorgegebenen Qualitätskomponenten erforderlich. Vor diesem Hintergrund hat die vorliegende Arbeit die Aufgabe für den Gewässertyp ‚Übergangsgewässer- Nordsee’ (Typ T1/T2) ein fischbasiertes Bewertungswerkzeug zu entwickeln, das den spezifischen Anforderungen der WRRL Rechnung trägt. Der Gewässertyp „Übergangsgewässer- Nordsee“ ist durch den ästuarinen Salinitätsgradienten charakterisiert und zeichnet sich durch das dynamische Zusammentreffen limnischer und mariner Elemente aus. Er bildet daher einen Lebensraum ganz eigener Prägung, der auch eine spezifische Fischfauna aufweist. Diese eigene Ausprägung machte im Hinblick auf die Qualitätskomponente Fischfauna einen spezifischen Bewertungsansatz für die Übergangsgewässer erforderlich. Dazu ist in der vorliegenden Arbeit ein multimetrisches Bewertungsverfahren konzipiert worden, das die Aspekte Artenspektrum, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna umfasst und dabei auf eine historische Referenzzönose als Bewertungsmaßstab Bezug nimmt. Mit der Erarbeitung eines entsprechenden fischbasierten Bewertungswerkzeuges wurde das Büro BioConsult Schuchardt & Scholle GbR im Dezember 2004 von den Ländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen beauftragt. Die Koordination des Projektes oblag dabei der Wassergütestelle Elbe und wurde von einer Fachgruppe aus Vertretern der Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg begleitet. […]“
-
Im Rahmen des Projektes „Die Bodenfauna des Crildumersieler Watts (Jade, Nordsee) und ihre Veränderung nach dem Eiswinter 1978/79“ wurde Frühjahr und Sommer 1979 das Ausmaß der Änderungen im Arten- und Individuenbestand der Bodenfauna durch den Eiswinter 1978/1979 im Vergleich zur Untersuchung von 1975 erfasst. An 5 Stationen wurden Siebproben entnommen und mit den Beprobungen von August 1975 verglichen.
-
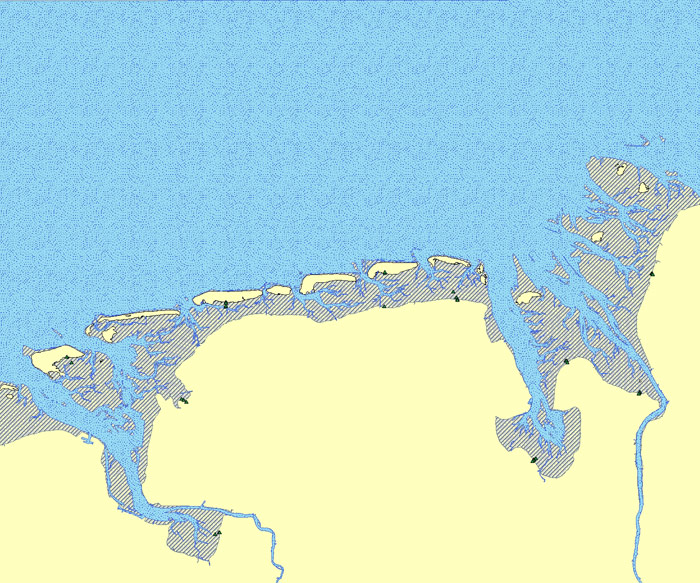
Dieser Layer bildet Kupfer im Sediment, <2000µm, 2005-2010 an der niedersächsischen Küste ab. Hierbei handelt es sich um aggregierte und harmonisierte Werte, die im Rahmen des Projektes MDI-DE für die Bewertung der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) erstellt und entwickelt wurden.
-
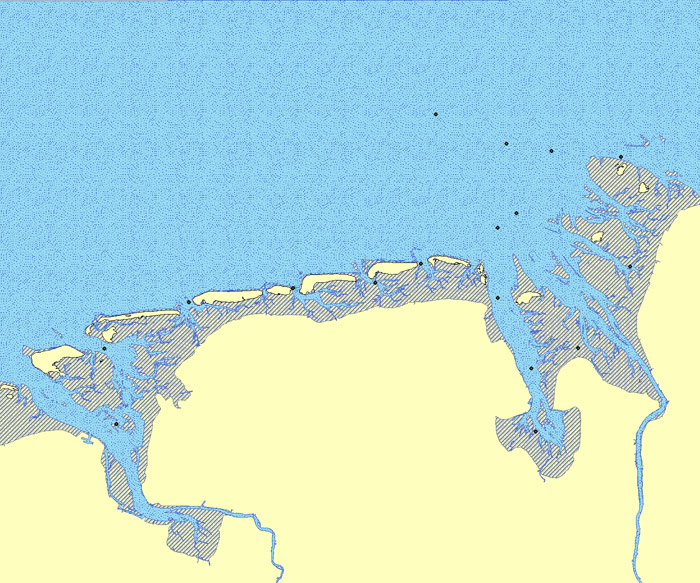
Dieser Layer bildet Arsen, gesamt im Wasser, 2005-2010 an der niedersächsischen Küste ab. Hierbei handelt es sich um aggregierte und harmonisierte Werte, die im Rahmen des Projektes MDI-DE für die Bewertung der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) erstellt und entwickelt wurden.
-
„Projektinhalte: Erste Ansätze zur Bewertung des ökologischen Zustands im Übergangsgewässer des Ems-Dollart-Ästuars wurden im 2003 – 2005 als Projekt „Ökologische Bewertungskonzepte am Beispiel des Ems-Dollart-Ästuars“ in deutschniederländischer Zusammenarbeit entwickelt. Ein Produkt der deutsch-niederländischen Kooperation war der „Bericht 2005“ als B-Bericht der EU im Rahmen der Einführung der Wasserrahmenrichtlinie. Wesentliche Grundlagen dazu wurden auf niederländischer und deutscher Seite im Rahmen unterschiedlicher Projekte erarbeitet, die bei den jeweiligen Fachbehörden angesiedelt waren und vor allem zu den Bewertungskonzepten Beiträge geliefert haben. Diese Form der Zusammenarbeit hat sich als sehr konstruktiv erwiesen. Im Zuge der Arbeiten zum „Bericht 2005“ zeigte sich, dass das Übergangsgewässer der Ems – so wie auch die Übergangsgewässer der anderen Flussmündungsgebiete - möglicherweise als „HMWB“ ausgewiesen wird und die Bewertungsansätze somit auf die Erreichung des ökologischen Potentials abgestimmt werden müssen. In Erfüllung des Zeitplans bei der Einführung der Wasserrahmenrichtlinie steht zeitgleich die Entwicklung von Monitoringplänen sowie die Abstimmung dieser Konzeptionen zwischen den Niederlanden und Deutschland („bilaterale Interkalibration“) an. Diese Arbeiten werden in laufenden Vorhaben in bewährter Form auf Projektbasis unter der Steuerung der Arbeitsgruppe Wasserqualität Ems-Dollart als Unterarbeitsgruppe der Ständigen Gewässerkommission Ems-Dollart durchgeführt […]. Dabei wird an die Arbeiten der vergangenen zwei Jahre unmittelbar angeknüpft und darauf aufgebaut. Folgende Inhalte liegen dem oben betitelten, seit 01. August 2005 laufenden Projekt (Bearbeitungszeit bis 15. 09. 06), das auf deutscher Seite beim NLWKN angesiedelt ist, zugrunde: Ziele des Vorhabens: Erneute Erwägung der Begrenzung und des Status: natürlich oder erheblich verändert; Entwicklung des ökologischen Potentials im Ems-Dollart Ästuar sowie eines darauf basierenden Bewertungsschemas, aufbauend auf einem Bewertungssystem für den guten ökologischen Zustand; Entwicklung eines auf die Erfordernisse der EG-WRRL abgestimmten Monitoringkonzeptes Initiierung von Feldarbeiten zur Datenverdichtung im Rahmen des Monitorings; Zusammenarbeit und Absprachen zwischen den inhaltlich parallelen Projekten in Deutschland und in den Niederlanden zur gemeinsamen Formulierung von ökologischem Potential, Bewertungsansätzen und Monitoringstrategien […]“
-
„Am 22. Dezember 2000 ist die EG – Wasserrahmenrichtlinie in Kraft getreten. Diese Richtlinie legt in Artikel 5, Absatz 1 fest, dass die Mitgliedsstaaten bis spätestens 4 Jahre nach in Kraft treten dafür sorgen, dass für die Flussgebietseinheit eine Analyse ihrer Merkmale und eine Überprüfung der Auswirkung menschlicher Tätigkeiten auf den Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers abgeschlossen wird. Ebenfalls muss eine wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung durchgeführt sein. Die Bestandsaufnahme muss gemäß Artikel 15 der EG - WRRL spätestens bis zum 22. März 2005 an die Europäische Kommission übermittelt werden. Die deutsch-niederländische Arbeitsgruppe Gewässergüte (Unterausschuss „G Ems-Dollart“ der Grenzgewässerkommission) legt in diesem Zusammenhang mit dem vorliegenden Bericht die Umsetzung dieser Verpflichtung für das Ems-DollartÄstuargebiet vor. Dabei ist nur das Oberflächengewässer berücksichtigt, da das Grundwasser im Ems-Dollartbereich für die Ökologie als nicht relevant eingeschätzt wird. Während der Erstellung des Berichtes ist deutlich geworden, dass für eine umfassende Beurteilung des Bearbeitungsgebietes zurzeit noch viele Kenntnislücken bestehen. Dieser Bericht stellt dennoch eine eindeutige Beschreibung der Problematik der Oberflächengewässer im Ems-Dollart-Ästuar dar. […]“
-
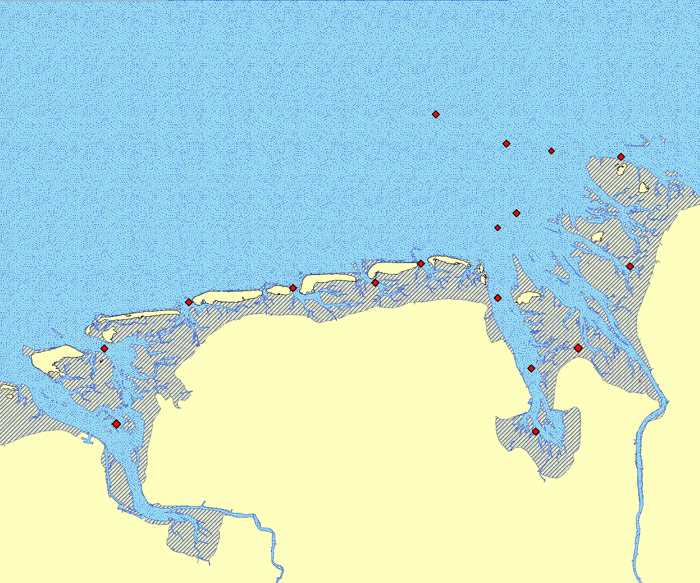
Dieser Layer bildet Kupfer, gesamt im Wasser, 2005-2010 an der niedersächsischen Küste ab. Hierbei handelt es sich um aggregierte und harmonisierte Werte, die im Rahmen des Projektes MDI-DE für die Bewertung der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) erstellt und entwickelt wurden.
-
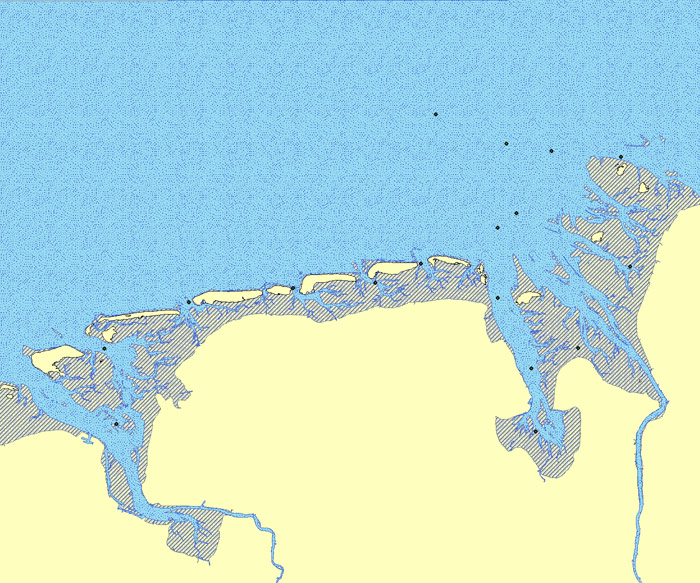
Dieser Layer bildet Blei, gesamt im Wasser, 2005-2010 an der niedersächsischen Küste ab. Hierbei handelt es sich um aggregierte und harmonisierte Werte, die im Rahmen des Projektes MDI-DE für die Bewertung der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) erstellt und entwickelt wurden.
-
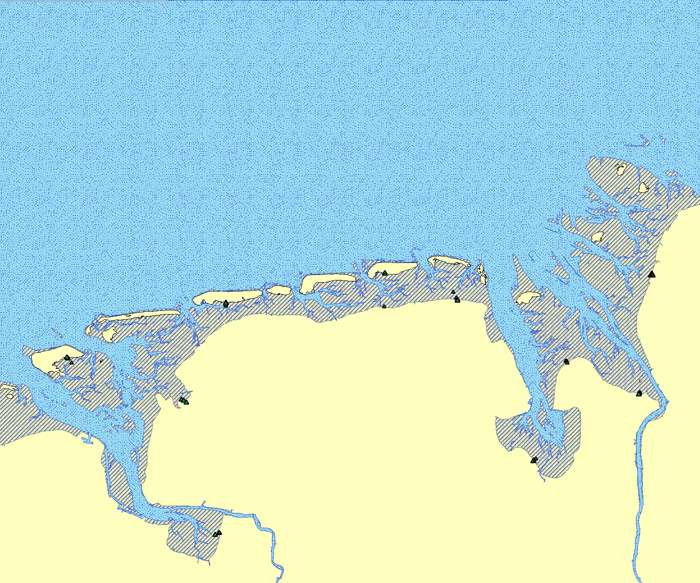
Dieser Layer bildet Quecksilber im Sediment, <20µm an der niedersächsischen Küste ab. Hierbei handelt es sich um aggregierte und harmonisierte Werte, die im Rahmen des Projektes MDI-DE für die Bewertung der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) erstellt und entwickelt wurden.
-
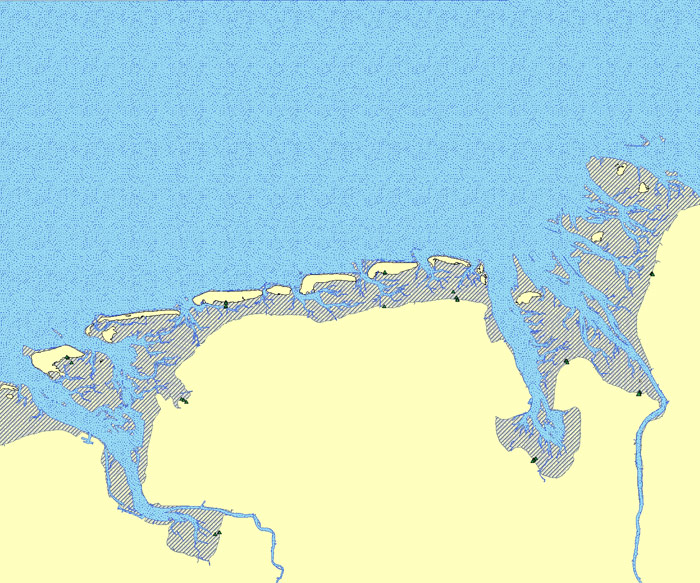
Dieser Layer bildet Cadmium im Sediment, <2000µm, 2005-2010 an der niedersächsischen Küste ab. Hierbei handelt es sich um aggregierte und harmonisierte Werte, die im Rahmen des Projektes MDI-DE für die Bewertung der Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) erstellt und entwickelt wurden.
 Alte Geodatensuche Niedersachsen
Alte Geodatensuche Niedersachsen